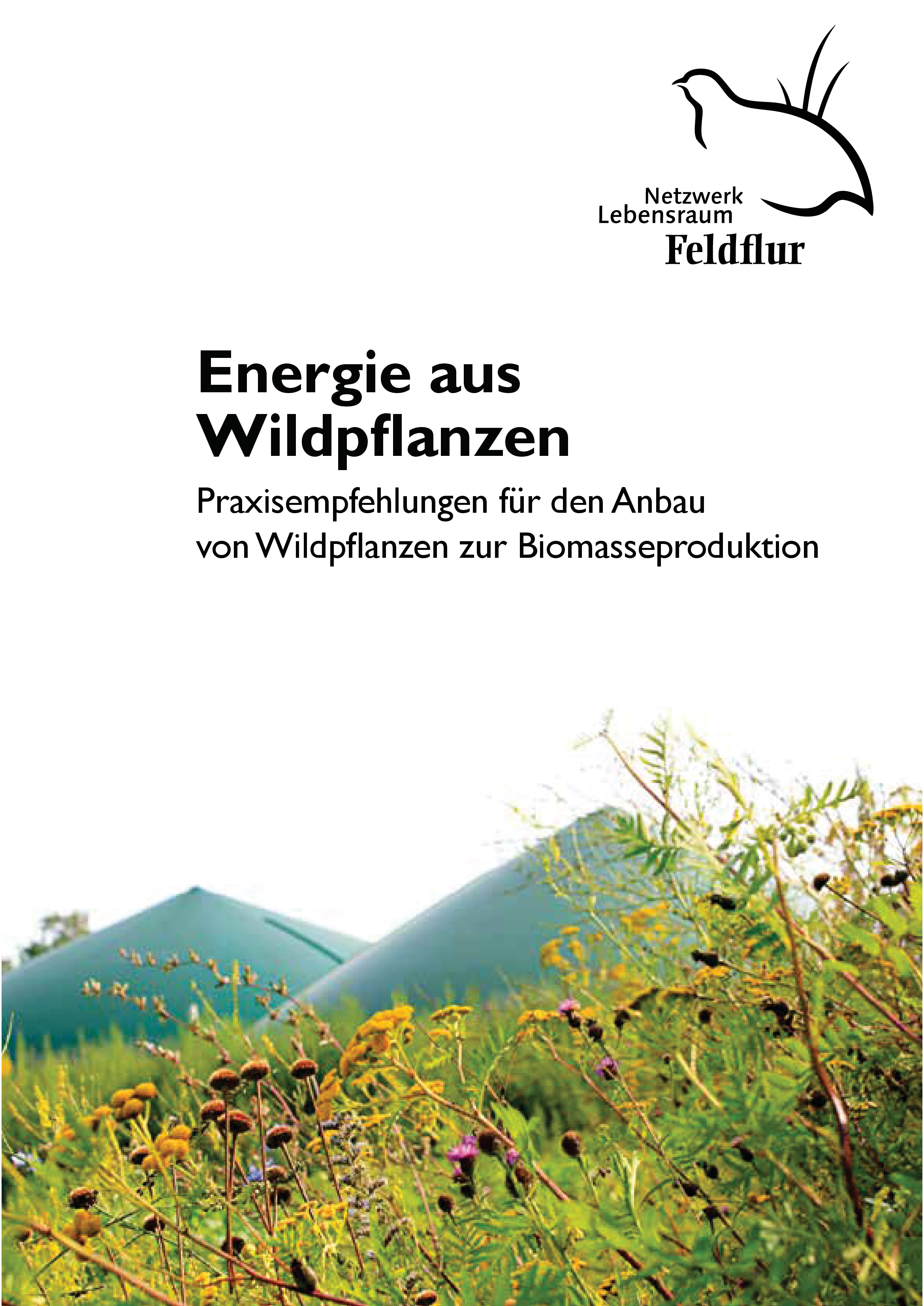Projekt Bunte Biomasse mit neuen Konditionen verlängert
Das ursprüngliche Projektziel des Projekts Bunte Biomasse von deutschlandweit 500 Hektar Maßnahmeflächen konnte bereits erreicht werden. Deshalb haben die Projektpartner (Veolia Stiftung, Deutscher Jagdverband, Deutsche Wildtier Stiftung) entschieden, das Projekt Bunte Biomasse bis zum Jahresende 2024 zu verlängern und gleichzeitig die Honorierung für neu abzuschließende Verträge auf nun 500 € pro Hektar und Jahr zu verdoppeln. Damit wird auf die Preissteigerungen am Saatgutmarkt sowie auf die gestiegenen Honorierungsansätze für mehrjährige Blühflächen in den öffentlichen Förderprogrammen reagiert.
In der verbleibenden Projektlaufzeit sollen vor allem in den östlichen Bundesländern sowie in Schleswig-Holstein und Hessen Vertragsflächen etabliert werden. Landwirte, die bereit sind, in diesem oder im kommenden Jahr mehrjährige, ertragreiche Wildpflanzenkulturen für die Biomasseproduktion zu etablieren und mindestens drei Jahre zu nutzen, können sich gerne bei uns melden.


 C. Kemnade
C. Kemnade Sarah Flach
Sarah Flach 
 Sabine Paltrinieri
Sabine Paltrinieri Deutsche Wildtier Stiftung
Deutsche Wildtier Stiftung